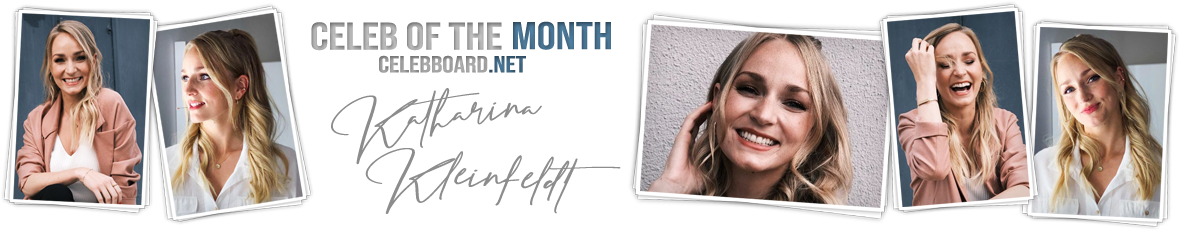SteveJ
V:I:P
- Registriert
- 21 Apr. 2010
- Themen
- 1.235
- Beiträge
- 3.752
- Reaktionen
- 9.645
"Christ ist erstanden!/ Freude und Glück dem Sterblichen,/ Schleichenden erblichen/ Mängel umwandeln!"
Noch rechtzeitig setzen Engelschor und Glockenklang ein, um den verzweifelten Heinrich Faust vor dem Freitod durch Gift zu bewahren:
“Welch tiefes Summen, welch ein heller Ton/ Zieht mit Gewalt das Glas von meinem Munde?/ Verkündiget ihr dumpfen Glocken schon/ Des Osterfestes erste Feierstunde?"
Was man vor lauter Gretchen-Liebesleid leicht vergisst: Johann Wolfgang von Goethes “Faust. Der Tragödie erster Teil" beginnt mit Ostern, mit den dunklen Stunden des Karsamstags vor der erlösenden Freude des Sonntags.
"Nacht" betitelt der Dichter die erste Szene und meint damit nicht nur die Tageszeit, sondern auch die Stimmung seines Protagonisten.
Dessen Lebensentwurf ist zusammengebrochen. Ihm ist bewusst geworden, dass ihn Gelehrsamkeit nicht weiterbringt.
Natur-Erforschung mit Magie zu betreiben, testet er in dieser Nacht als letzten, eher schrägen Versuch.
Erneut scheitert er, weil er den Kräften selbst der einfacheren Natur (Erdgeist) nicht gewachsen ist.
Er, der sonst Überhebliche, empfindet sich nicht mal mehr als Mensch, sondern als Wurm im Staub.
Mit dem Glauben hat er's ja nicht mehr so, jedoch: “Was sucht ihr, mächtig und gelind,/ Ihr Himmelstöne mich im Staube?"
Sie wecken seine Religiosität, die in der Jugend eingeübt wurde. Der alte Herr erinnert sich gerührt daran und an das Glück in der Natur, an die "Frühlingsfeier".
Genau die inszeniert Goethe in der folgenden Tag-Szene “Vor dem Tor".
Raus aus der muffigen Stube, aus der engen Stadt, aus der Einsamkeit, aus Finsternis und Verzweiflung.
Selbst die eiserne Ständeordnung ist Ausflug ins Grüne aufgehoben.
Es mischen sich Soldaten und Bürgermädchen, Mägde und Handwerker, Bettler und Wohlhabende, Bauern und der “Herr Doktor" (den Astrologen Faust, ein Luther-Zeitgenosse, gab es tatsächlich), der die berühmten Verse voll von Tod-Leben-Symbolik sagt:
"Vom Eise befreit sind Strom und Bäche/ Durch des Frühlings holden, belebenden Blick,/ Im Tale grünet Hoffnungsglück."
Ausgerechnet in diesem Idyll, in das hinein Faust seinerseits “auferstanden" ist, begegnet ihm der Teufel als idyllgerechter Pudel.
Zurück im Haus decouvriert sich nach Hin und Her Mephistopheles als "des Pudels Kern":
“Ein Teil von jener Kraft,/ Die stets das Böse will, und stets das Gute schafft."
“Ich bin der Geist, der stets verneint! - So ist denn alles, was ihr Sünde,/ Zerstörung, kurz das Böse nennt,/ Mein eigentliches Element."
Danach kommt es zügig zu der Wette zwischen Satan und Faust:
“Werd ich zum Augenblicke sagen:/ Verweile doch! Du bist so schön!/ Dann magst du mich in Fesseln schlagen,/ dann will ich gern zugrunde gehen!"
Der Autor hat längst so viele Indizien hinterlassen, dass eindeutig ist: Der Teufel hat keine Chance.
Ostern vollendet den göttlichen Heilsplan mit Christi Tod und Auferstehung.
Ostern reißt den Suizidalen vom Tod weg und schenkt ihm ein neues, junges Leben.
Dass das nur durch den Bösen selbstgelingen kann, verdanken wir gen dem Goethe'schen Humor.
Den lässt er übrigens bereits im “Prolog im Himmel" Gott angedeihen, der recht locker mit Mephisto plaudert:
“Ich habe deinesgleichen nie gehasst/ Von allen Geistern, die verneinen,/ Ist mir der Schalk am wenigsten zur Last."
Obwohl der Herr am Anfang von Goethes Monumentalwerk Fäden in der Hand hält, weiß der Dichter doch, dass es am Ende die Frauen sind, die's richten müssen.
So sorgen in “Faust. Der Tragödie Zweiter Teil" die Madonna und “Die eine Büßerin, sonst Gretchen genannt" dafür, dass “Faustens Unsterbliches" in den Himmel gehievt wird - mit dem Fazit:
“Das Ewigweibliche/ Zieht uns hinan."
Noch rechtzeitig setzen Engelschor und Glockenklang ein, um den verzweifelten Heinrich Faust vor dem Freitod durch Gift zu bewahren:
“Welch tiefes Summen, welch ein heller Ton/ Zieht mit Gewalt das Glas von meinem Munde?/ Verkündiget ihr dumpfen Glocken schon/ Des Osterfestes erste Feierstunde?"
Was man vor lauter Gretchen-Liebesleid leicht vergisst: Johann Wolfgang von Goethes “Faust. Der Tragödie erster Teil" beginnt mit Ostern, mit den dunklen Stunden des Karsamstags vor der erlösenden Freude des Sonntags.
"Nacht" betitelt der Dichter die erste Szene und meint damit nicht nur die Tageszeit, sondern auch die Stimmung seines Protagonisten.
Dessen Lebensentwurf ist zusammengebrochen. Ihm ist bewusst geworden, dass ihn Gelehrsamkeit nicht weiterbringt.
Natur-Erforschung mit Magie zu betreiben, testet er in dieser Nacht als letzten, eher schrägen Versuch.
Erneut scheitert er, weil er den Kräften selbst der einfacheren Natur (Erdgeist) nicht gewachsen ist.
Er, der sonst Überhebliche, empfindet sich nicht mal mehr als Mensch, sondern als Wurm im Staub.
Mit dem Glauben hat er's ja nicht mehr so, jedoch: “Was sucht ihr, mächtig und gelind,/ Ihr Himmelstöne mich im Staube?"
Sie wecken seine Religiosität, die in der Jugend eingeübt wurde. Der alte Herr erinnert sich gerührt daran und an das Glück in der Natur, an die "Frühlingsfeier".
Genau die inszeniert Goethe in der folgenden Tag-Szene “Vor dem Tor".
Raus aus der muffigen Stube, aus der engen Stadt, aus der Einsamkeit, aus Finsternis und Verzweiflung.
Selbst die eiserne Ständeordnung ist Ausflug ins Grüne aufgehoben.
Es mischen sich Soldaten und Bürgermädchen, Mägde und Handwerker, Bettler und Wohlhabende, Bauern und der “Herr Doktor" (den Astrologen Faust, ein Luther-Zeitgenosse, gab es tatsächlich), der die berühmten Verse voll von Tod-Leben-Symbolik sagt:
"Vom Eise befreit sind Strom und Bäche/ Durch des Frühlings holden, belebenden Blick,/ Im Tale grünet Hoffnungsglück."
Ausgerechnet in diesem Idyll, in das hinein Faust seinerseits “auferstanden" ist, begegnet ihm der Teufel als idyllgerechter Pudel.
Zurück im Haus decouvriert sich nach Hin und Her Mephistopheles als "des Pudels Kern":
“Ein Teil von jener Kraft,/ Die stets das Böse will, und stets das Gute schafft."
“Ich bin der Geist, der stets verneint! - So ist denn alles, was ihr Sünde,/ Zerstörung, kurz das Böse nennt,/ Mein eigentliches Element."
Danach kommt es zügig zu der Wette zwischen Satan und Faust:
“Werd ich zum Augenblicke sagen:/ Verweile doch! Du bist so schön!/ Dann magst du mich in Fesseln schlagen,/ dann will ich gern zugrunde gehen!"
Der Autor hat längst so viele Indizien hinterlassen, dass eindeutig ist: Der Teufel hat keine Chance.
Ostern vollendet den göttlichen Heilsplan mit Christi Tod und Auferstehung.
Ostern reißt den Suizidalen vom Tod weg und schenkt ihm ein neues, junges Leben.
Dass das nur durch den Bösen selbstgelingen kann, verdanken wir gen dem Goethe'schen Humor.
Den lässt er übrigens bereits im “Prolog im Himmel" Gott angedeihen, der recht locker mit Mephisto plaudert:
“Ich habe deinesgleichen nie gehasst/ Von allen Geistern, die verneinen,/ Ist mir der Schalk am wenigsten zur Last."
Obwohl der Herr am Anfang von Goethes Monumentalwerk Fäden in der Hand hält, weiß der Dichter doch, dass es am Ende die Frauen sind, die's richten müssen.
So sorgen in “Faust. Der Tragödie Zweiter Teil" die Madonna und “Die eine Büßerin, sonst Gretchen genannt" dafür, dass “Faustens Unsterbliches" in den Himmel gehievt wird - mit dem Fazit:
“Das Ewigweibliche/ Zieht uns hinan."
Zuletzt bearbeitet: