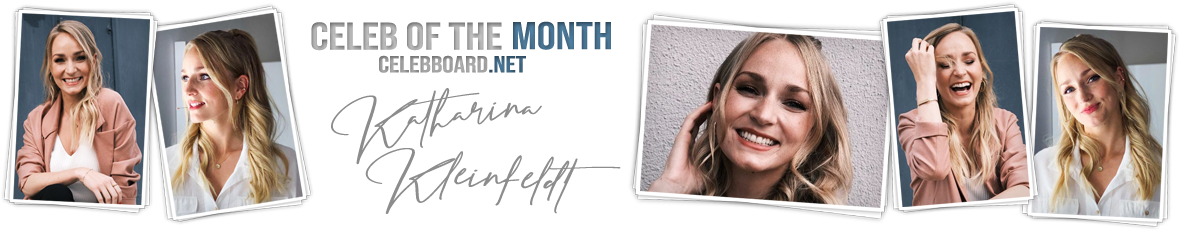SteveJ
V:I:P
- Registriert
- 21 Apr. 2010
- Themen
- 1.235
- Beiträge
- 3.753
- Reaktionen
- 9.647
Wir waren Kinder. Und wir träumten von den Sternen. Der “Krieg der Sterne“ hatte uns im Kino zu einer weit entfernten Galaxie geführt und aufgewühlt.
“Raumschiff Enterprise“ brachte uns zu fernen Welten, auch wenn wir als Kinder da nicht immer alles verstanden haben.
Und dann – plötzlich und aus dem Nichts – am 27. September 1980, an einem Samstagmittag, erklang zum ersten Mal die verheißungsvolle sphärisch-elektronische Titelmelodie von Christian Bruhn aus den Lautsprechern des Fernsehers.
Die damalige deutsche Stimme von Captain Kirk, Gert Günther Hoffmann, sagte nur zwei Worte: Captain Future.
 www.youtube.com
www.youtube.com
Ohne auch nur eine Sekunde gesehen zu haben, hatte man sofort Gänsehaut.
Die japanische Zeichentrickserie von Toei Animation riss einen an Bord des ungewöhnlichen Raumschiffs “Comet“ mit in die Galaxie.
Zusammen mit dem Helden Captain Future und seinen Gefährten. Crag, der Roboter, und Otto, der Androide – die schnell zu TV-Brüdern von uns wurden. So wie Simon Wright, das fliegende Gehirn, zu einer Respektfigur wuchs. Das war nicht irgendeine Besatzung oder ein zusammengewürfelter Haufen. Es war eine Familie. Und wie der junge Ken in der Serie wollten wir uns auch an Bord der Comet schleichen, um mit ihnen zu den Sternen zu fliegen.
45 Jahre später ist die Erinnerung an die Geschichten etwas verblasst.
Geblieben sind jedoch die mit “Captain Future“ verbundenen Gefühle. Die Begeisterung und die Faszination für das Universum.
Zumal die Serie auch einige grundlegende Ideen in die Köpfe gesetzt hat, die bis heute Bestand haben:
Er brach voller Optimismus in eine Zukunft auf, die zwischen den Sternen lag. Es war ein Funke der Hoffnung für uns Kinder des Kalten Krieges.
Es lässt sich nicht mehr an einer Episode festmachen oder einer Story. Aber an den Figuren, die bis heute etwas Warmes und Gutes in uns wecken.
Und eine Sehnsucht. Nach den Sternen und einer besseren Zukunft, die es selbst in der Serie nicht immer gab – aber für die Captain Future gekämpft hat.
Und dennoch ist er auch in unseren Köpfen in Vergessenheit geraten. Es wurde zu etwas, das lange her war und weit entfernt schien. Bis jetzt...
Denn nun lassen der französische Zeichner Alexis Tallone und der Autor Sylvian Runberg Captain Future wieder auferstehen.
Und dafür bekamen sie die Erlaubnis des damaligen japanischen Anime-Produzenten Toei Animation, die Figuren aus der Serie zu verwenden.
Wir treffen auf alte Bekannte, die sich kaum bis wenig von dem unterscheiden, was wir als Kinder gesehen haben.
Der Anblick allein ist pure Nostalgie.
Und in den Köpfen hören wir vielleicht auch wieder die zeitlose Titelmelodie von Christian Bruhn, die bis heute nichts von ihrer Anziehungskraft verloren hat.
Das Comicbuch trägt den Titel “Der ewige Herrscher“, und sofort denken Fans an den “Herrscher von Megara“.
Erinnerungsfetzen huschen durch den Kopf. Da war doch etwas mit der Rückverwandlung von Menschen in affenähnliche Urzeitkreaturen.
Und es stimmt. In dem Comicbuch geht es tatsächlich um den Planeten Megara, auf dem es einst eine eigene Zivilisation gab.
Die ist aber untergegangen. Und die Nachkommen jener Hochkultur, die Hybriden von Echsen und Fröschen ähneln, sind nun nicht mehr als Diener oder Arbeiter in einer menschlichen Kolonie.
Aber dann gibt es eine Reihe seltsamer Vorfälle. Captain Future soll das untersuchen.
Allerdings ist doch nicht alles beim Alten geblieben.
Wir erfahren zunächst, warum Captain Future, der eigentlich Curtis Newton heißt, ohne Eltern aufgewachsen ist.
Er scheint auch ein wenig nahbarer zu sein als noch in der TV-Serie.
Die Agentin Joan Landor dagegen hat die größte Veränderung durchgemacht.
Sie ist nicht mehr so naiv wie damals, sondern wirkt erwachsener. Und sie verhält sich auch weniger unterwürfig oder himmelt ständig den Captain an.
Sie ist jetzt eine selbstbewusste Frau mit eigener Meinung, die sich im Team behaupten kann.
Aber auch in der Erzählung hat sich etwas verändert.
Wo es früher einfach eine ominöse Strahlung war, die eine Fernwirkung hat, sind es jetzt Nanoroboter, die Effekte auslösen.
Und war das Team der Comet oft zahlenmäßig unterlegen, kommen nun Drohnen zur Unterstützung zum Einsatz.
Das alles wirkt moderner und ist an den tatsächlichen Fortschritt der vergangenen 45 Jahre angepasst.
Und es tut der Geschichte nicht weh, sondern macht sie aktueller.
Zumal dem deutschen Leser nun einige Dinge auffallen werden, die er vor 45 Jahren nicht gesehen hat.
Nicht, weil man als Kind einiges nicht verstanden hat. Tatsächlich hat das ZDF für die deutsche Fassung teilweise mehrere Minuten aus den Episoden geschnitten.
Weil es zu brutal für Kinder schien oder jemand manche Themen für zu erwachsen hielt.
Trotzdem gab es damals Elternproteste.
Einige Folgen fielen ganz weg. Auch die Reihenfolge wurde verändert, was uns als Kinder nur manchmal auffiel – weil plötzlich Figuren eingeführt wurden, die wir doch längst kannten.
Dafür war die Musik in der ZDF-Fassung dank Christian Bruhn definitiv stimmiger und elektronischer als im Original mit seinen Disco- und Jazz-Anklängen.
Im Comicbuch sehen wir expliziter als damals im Fernsehen, wie das Volk von Megara unterdrückt wird und unter Rassismus leidet.
In der nun von Menschen besiedelten Welt. Die Erde hat sich vielleicht schneller in der Galaxis ausgebreitet und Planeten für sich beansprucht, als es gut für sie war.
Und auch der irdischen Zentralregierung entgleitet langsam die Kontrolle. Aufgrund von Korruption und Einzelinteressen.
Gerade deshalb braucht man unabhängige Agenten wie Captain Future, die nicht korrumpiert sind.
Die Stärke des Comicbuchs ist es, dass der Leser nicht mit der Nase auf alles gestoßen wird. Es ist ein Satz da, eine Darstellung und ein Ereignis dort.
Daraus formt sich ein Gesamtbild im Kopf um die Hauptgeschichte.
Und es zeigt, wie vielfältig und tiefgründig das Universum von Captain Future noch immer ist – und schon damals war. Trotz aller Schnitte in der deutschen Fassung.
Zumal in der Serie, ob Fernsehen oder Comicbuch, eine ganze Reihe aktueller Themen angesprochen werden.
Können künstliche Wesen mit künstlicher Intelligenz mitfühlender und klüger sein als Menschen?
Wie sehr hängt unser Selbstbild von unserer Erscheinung ab? Wie geht ein Mensch mit einem Trauma um? Was ist Gerechtigkeit?
Bedeutet technologischer Fortschritt ein Ende der sozialen Ungleichheit? Welchen Wert hat das Leben?
Und wie wirkt unheilvolle Propaganda und das Versprechen auf ein besseres Leben?
Definitive Antworten gibt es nicht, dafür aber Positionen der Figuren, die sie nicht immer sympathisch erscheinen lassen.
Insbesondere als einmal Folter in Erwägung gezogen wird. Aber gerade das macht das Comicbuch teilweise erwachsener und besser als die Serie von damals.
Bis auf das überaus optimistische Ende, das etwas abrupt kommt. Damit können wir leben.
Was aber negativ auffällt: Die Dialoge zumindest in der deutschen Fassung sind oft nicht gelungen.
“Immer am Herumgammeln“, “Immer noch am Fantasieren“, “Wie hat er von unserem Kommen erfahren?“. Das klingt nicht so gut...
Und wenn Captain Future manchmal Crag oder Otto mit “mein Bruder“ anspricht, soll das Verbundenheit zeigen.
Es weckt aber eher Ghetto-Sprache-Assoziationen. Das geht besser.
Dafür ist es eine unbeabsichtigte Hommage an das eigentliche Original.
Der US-Schriftsteller Edmond Hamilton hatte mehr oder weniger als Auftragsarbeit die meisten der Abenteuer von “Captain Future“ geschrieben, die zwischen 1940 und 1944 in Magazinen erschienen.
Als sogenannte “Pulp Fiction“, weil sie auf billigem Papier (Pulp) gedruckt worden waren.
Und so fantasievoll, ideen- und facettenreich seine Geschichten waren, nicht alles war gelungen. Insbesondere seine Dialoge litten unter der produzierten Masse und waren nicht immer perfekt.
Dennoch gilt er heute wegen seiner Kreativität als ein unterschätzter Autor der großen Science-Fiction-Ära in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Das Comicbuch, das hoffentlich nur das erste einer Reihe ist, lässt uns sein berühmtestes Werk neu erleben.
Modernisiert und abgestaubt. Und es hat nichts von seinem Reiz und der Faszination verloren, die uns mitriss.
Damals, als wir Kinder waren und von den Sternen träumten...
“Raumschiff Enterprise“ brachte uns zu fernen Welten, auch wenn wir als Kinder da nicht immer alles verstanden haben.
Und dann – plötzlich und aus dem Nichts – am 27. September 1980, an einem Samstagmittag, erklang zum ersten Mal die verheißungsvolle sphärisch-elektronische Titelmelodie von Christian Bruhn aus den Lautsprechern des Fernsehers.
Die damalige deutsche Stimme von Captain Kirk, Gert Günther Hoffmann, sagte nur zwei Worte: Captain Future.
- YouTube
Enjoy the videos and music that you love, upload original content and share it all with friends, family and the world on YouTube.
Ohne auch nur eine Sekunde gesehen zu haben, hatte man sofort Gänsehaut.
Die japanische Zeichentrickserie von Toei Animation riss einen an Bord des ungewöhnlichen Raumschiffs “Comet“ mit in die Galaxie.
Zusammen mit dem Helden Captain Future und seinen Gefährten. Crag, der Roboter, und Otto, der Androide – die schnell zu TV-Brüdern von uns wurden. So wie Simon Wright, das fliegende Gehirn, zu einer Respektfigur wuchs. Das war nicht irgendeine Besatzung oder ein zusammengewürfelter Haufen. Es war eine Familie. Und wie der junge Ken in der Serie wollten wir uns auch an Bord der Comet schleichen, um mit ihnen zu den Sternen zu fliegen.
45 Jahre später ist die Erinnerung an die Geschichten etwas verblasst.
Geblieben sind jedoch die mit “Captain Future“ verbundenen Gefühle. Die Begeisterung und die Faszination für das Universum.
Zumal die Serie auch einige grundlegende Ideen in die Köpfe gesetzt hat, die bis heute Bestand haben:
- Rassismus, Sklaverei, Unterdrückung gehören nicht in unsere Welt.
- Intelligenz und Engagement lösen Probleme.
- Wissenschaft und Technik sind cool und nicht öde oder langweilig.
- Hass lässt sich überwinden.
- Und jeder kann sich ändern oder verdient eine Chance. Denn es ist Menschlichkeit, die Menschen ausmacht.
Er brach voller Optimismus in eine Zukunft auf, die zwischen den Sternen lag. Es war ein Funke der Hoffnung für uns Kinder des Kalten Krieges.
Es lässt sich nicht mehr an einer Episode festmachen oder einer Story. Aber an den Figuren, die bis heute etwas Warmes und Gutes in uns wecken.
Und eine Sehnsucht. Nach den Sternen und einer besseren Zukunft, die es selbst in der Serie nicht immer gab – aber für die Captain Future gekämpft hat.
Und dennoch ist er auch in unseren Köpfen in Vergessenheit geraten. Es wurde zu etwas, das lange her war und weit entfernt schien. Bis jetzt...
Denn nun lassen der französische Zeichner Alexis Tallone und der Autor Sylvian Runberg Captain Future wieder auferstehen.
Und dafür bekamen sie die Erlaubnis des damaligen japanischen Anime-Produzenten Toei Animation, die Figuren aus der Serie zu verwenden.
Wir treffen auf alte Bekannte, die sich kaum bis wenig von dem unterscheiden, was wir als Kinder gesehen haben.
Der Anblick allein ist pure Nostalgie.
Und in den Köpfen hören wir vielleicht auch wieder die zeitlose Titelmelodie von Christian Bruhn, die bis heute nichts von ihrer Anziehungskraft verloren hat.
Das Comicbuch trägt den Titel “Der ewige Herrscher“, und sofort denken Fans an den “Herrscher von Megara“.
Erinnerungsfetzen huschen durch den Kopf. Da war doch etwas mit der Rückverwandlung von Menschen in affenähnliche Urzeitkreaturen.
Und es stimmt. In dem Comicbuch geht es tatsächlich um den Planeten Megara, auf dem es einst eine eigene Zivilisation gab.
Die ist aber untergegangen. Und die Nachkommen jener Hochkultur, die Hybriden von Echsen und Fröschen ähneln, sind nun nicht mehr als Diener oder Arbeiter in einer menschlichen Kolonie.
Aber dann gibt es eine Reihe seltsamer Vorfälle. Captain Future soll das untersuchen.
Allerdings ist doch nicht alles beim Alten geblieben.
Wir erfahren zunächst, warum Captain Future, der eigentlich Curtis Newton heißt, ohne Eltern aufgewachsen ist.
Er scheint auch ein wenig nahbarer zu sein als noch in der TV-Serie.
Die Agentin Joan Landor dagegen hat die größte Veränderung durchgemacht.
Sie ist nicht mehr so naiv wie damals, sondern wirkt erwachsener. Und sie verhält sich auch weniger unterwürfig oder himmelt ständig den Captain an.
Sie ist jetzt eine selbstbewusste Frau mit eigener Meinung, die sich im Team behaupten kann.
Aber auch in der Erzählung hat sich etwas verändert.
Wo es früher einfach eine ominöse Strahlung war, die eine Fernwirkung hat, sind es jetzt Nanoroboter, die Effekte auslösen.
Und war das Team der Comet oft zahlenmäßig unterlegen, kommen nun Drohnen zur Unterstützung zum Einsatz.
Das alles wirkt moderner und ist an den tatsächlichen Fortschritt der vergangenen 45 Jahre angepasst.
Und es tut der Geschichte nicht weh, sondern macht sie aktueller.
Zumal dem deutschen Leser nun einige Dinge auffallen werden, die er vor 45 Jahren nicht gesehen hat.
Nicht, weil man als Kind einiges nicht verstanden hat. Tatsächlich hat das ZDF für die deutsche Fassung teilweise mehrere Minuten aus den Episoden geschnitten.
Weil es zu brutal für Kinder schien oder jemand manche Themen für zu erwachsen hielt.
Trotzdem gab es damals Elternproteste.
Einige Folgen fielen ganz weg. Auch die Reihenfolge wurde verändert, was uns als Kinder nur manchmal auffiel – weil plötzlich Figuren eingeführt wurden, die wir doch längst kannten.
Dafür war die Musik in der ZDF-Fassung dank Christian Bruhn definitiv stimmiger und elektronischer als im Original mit seinen Disco- und Jazz-Anklängen.
Im Comicbuch sehen wir expliziter als damals im Fernsehen, wie das Volk von Megara unterdrückt wird und unter Rassismus leidet.
In der nun von Menschen besiedelten Welt. Die Erde hat sich vielleicht schneller in der Galaxis ausgebreitet und Planeten für sich beansprucht, als es gut für sie war.
Und auch der irdischen Zentralregierung entgleitet langsam die Kontrolle. Aufgrund von Korruption und Einzelinteressen.
Gerade deshalb braucht man unabhängige Agenten wie Captain Future, die nicht korrumpiert sind.
Die Stärke des Comicbuchs ist es, dass der Leser nicht mit der Nase auf alles gestoßen wird. Es ist ein Satz da, eine Darstellung und ein Ereignis dort.
Daraus formt sich ein Gesamtbild im Kopf um die Hauptgeschichte.
Und es zeigt, wie vielfältig und tiefgründig das Universum von Captain Future noch immer ist – und schon damals war. Trotz aller Schnitte in der deutschen Fassung.
Zumal in der Serie, ob Fernsehen oder Comicbuch, eine ganze Reihe aktueller Themen angesprochen werden.
Können künstliche Wesen mit künstlicher Intelligenz mitfühlender und klüger sein als Menschen?
Wie sehr hängt unser Selbstbild von unserer Erscheinung ab? Wie geht ein Mensch mit einem Trauma um? Was ist Gerechtigkeit?
Bedeutet technologischer Fortschritt ein Ende der sozialen Ungleichheit? Welchen Wert hat das Leben?
Und wie wirkt unheilvolle Propaganda und das Versprechen auf ein besseres Leben?
Definitive Antworten gibt es nicht, dafür aber Positionen der Figuren, die sie nicht immer sympathisch erscheinen lassen.
Insbesondere als einmal Folter in Erwägung gezogen wird. Aber gerade das macht das Comicbuch teilweise erwachsener und besser als die Serie von damals.
Bis auf das überaus optimistische Ende, das etwas abrupt kommt. Damit können wir leben.
Was aber negativ auffällt: Die Dialoge zumindest in der deutschen Fassung sind oft nicht gelungen.
“Immer am Herumgammeln“, “Immer noch am Fantasieren“, “Wie hat er von unserem Kommen erfahren?“. Das klingt nicht so gut...
Und wenn Captain Future manchmal Crag oder Otto mit “mein Bruder“ anspricht, soll das Verbundenheit zeigen.
Es weckt aber eher Ghetto-Sprache-Assoziationen. Das geht besser.
Dafür ist es eine unbeabsichtigte Hommage an das eigentliche Original.
Der US-Schriftsteller Edmond Hamilton hatte mehr oder weniger als Auftragsarbeit die meisten der Abenteuer von “Captain Future“ geschrieben, die zwischen 1940 und 1944 in Magazinen erschienen.
Als sogenannte “Pulp Fiction“, weil sie auf billigem Papier (Pulp) gedruckt worden waren.
Und so fantasievoll, ideen- und facettenreich seine Geschichten waren, nicht alles war gelungen. Insbesondere seine Dialoge litten unter der produzierten Masse und waren nicht immer perfekt.
Dennoch gilt er heute wegen seiner Kreativität als ein unterschätzter Autor der großen Science-Fiction-Ära in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Das Comicbuch, das hoffentlich nur das erste einer Reihe ist, lässt uns sein berühmtestes Werk neu erleben.
Modernisiert und abgestaubt. Und es hat nichts von seinem Reiz und der Faszination verloren, die uns mitriss.
Damals, als wir Kinder waren und von den Sternen träumten...